Detailansicht
| Vorname | Ernst | 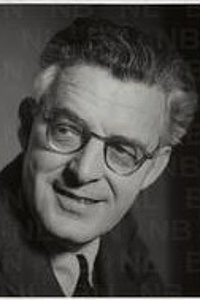 |
| Nachname | Balzli | |
| Geburtstag | 10.04.1902 | |
| Todestag | 03.01.1959 | |
| Personennummer | B062 |
Persönliche Angaben
Ernst Balzli wurde in Ostermundigen BE geboren. Er war das achte von elf und das fünfte von acht lebenden Kindern der Familie Balzli. Er wuchs mit den Geschwistern Emil, Gottfried, Frieda und Anna auf. Die Schwestern Lina, Elise und Marie standen, als Ernst die Schule besuchte, bereits in einer beruflichen Tätigkeit und hielten sich nicht mehr in der Familie auf. Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Eltern waren bescheiden und von der Armut beherrscht. Der häufige Wohnungswechsel, Krankheit und Todesfälle beeinträchtigten das Wohlergehen der Familie. Der karge Verdienst des Vaters, der zuerst als Handlanger und als Giessereiarbeiter arbeitete, reichte kaum aus, um die Familie auch nur notdürftig erhalten zu können. Zeitweise war der zusätzliche Verdienst der Mutter mit Waschen und Reinigungsarbeiten unerlässlich. Wenn Ernst Balzli in seinen Erzählungen und Theaterstücken die bittere Not, von der die heutige Zeit kaum mehr einen Begriff hat, schildert, dann bot ihm dazu die eigene Jugendzeit die eindrückliche Anschauung. In Habstetten bewohnte die Familie von 1910 bis 1920 ein altes Bauernhaus. Beim Bauern und Hausmeister mussten die Buben kräftig mithelfen und lernten dabei die landwirtschaftlichen Arbeiten von Grund auf kennen. Eindrücklich waren in seiner Jugendzeit die sonntäglichen Spaziergänge mit dem Vater durch den Wald. Der Vater, dem Gemüthaften verpflichtet, trug sonntags seine Mundharfe mit sich und spielte den Buben seine Weisen vor oder sang mit ihnen. Ein weiteres Sonntagsvergnügen der Balzlibuben war im Sommer und Herbst das Hornussen, worin sich Ernst grosse Geschicklichkeit erwarb. Er war schon zur Schulzeit ein ausgezeichneter Schläger. Tatsächlich hat er in Grafenried während einiger Zeit in der Hornussergesellschaft mitgewirkt.
"He nu, so muess me dänk i d’Schuel", diese Überschrift hat Ernst über eine reizende Sammlung von Kinderversen gesetzt. Das erste Schuljahr besuchte er in Ostermundigen. Als die Familie 1910 nach Habstetten übersiedelte, war sein Schulort in Bolligen. Er muss ein sehr guter Schüler gewesen sein, denn sein Lehrer ermutigte ihn am Ende des vierten Schuljahres, sich für die Sekundarschule anzumelden. Sein Vater lehnte ab, denn damals war dies nur für wohlhabende und bildungsfreudige Eltern vorgesehen. Lehrer Käser aber liess nicht locker und erreichte, dass Ernst eine Freistelle zugesichert wurde, womit ihm das Schulgeld erlassen wurde und die Eltern nur noch für die Lehrmittel und Schulmaterialien aufzukommen hatten, was schliesslich Vater bewog, seine Einwilligung zu geben. Als Ernst im Frühling 1913 die Sekundarschule in Bolligen begann, wirkten an ihr unter anderem zwei Lehrer sprachlich-historischer Richtung. Da war Balzlis Lieblingslehrer, der strenge aber feinfühlende Hans Wagner, sprachlich begabt und ausgerüstet mit einer vorzüglichen Lehrbegabung, dazu ein fähiger Dichter. Die fünf Sekundarschuljahre wurden für Ernst zur Grundlage seiner frühen seelischen und geistigen Prägung. Schon damals war Ernst von einer starken Leselust gepackt. Schon in der Sekundarschulzeit hat er seine ersten Gedichte verfasst.
Ernst Balzli war eigentlich von seinem Vater als Arbeiter in der Zentralheizungsfabrik Zent in Ostermundigen vorgesehen, wo er seit einigen Jahren tägig war. Insgeheim wollte Ernst Arzt werden, hat sich aber dazu nie geäussert, wohl wissend, dass die Studiumskosten für seine Eltern nicht zumutbar gewesen wären. Als sein Sekundarschullehrer von der getroffenen Abmachung mit der Firma Zent vernahm, schaltete er sich ein, in der Meinung, dass sich Ernst mit seinen Begabungen am besten für den Lehrerberuf eignen würde. Das Stipendium für die Ausbildung übernahm der hochverdiente Gönner, der Arzt Dr. Fetscherin in Bolligen, welcher die Familienverhältnisse kannte. Im Februar 1918 bestand Ernst Balzli die Aufnahmeprüfung ins evangelische Lehrerseminar auf dem Muristalden in Bern. Im Seminar erwachte der künftige Formkünstler. Mit verblüffender Leichtigkeit vermochte er gute Verse aus dem Ärmel zu schütteln.
Auf den 1. Mai 1922 wurde Ernst Balzli an die Oberschule in Grafenried gewählt. Aus der Welt des Seminars galt es für ihn, seinen Weg künftig unter Bauersleuten zu finden. Während den ersten drei Jahren wohnte er bei Familie Liechti, die eine Landwirtschaft und Metzgerei betrieb. Hier war er sehr gut aufgehoben und half mit Vorliebe bei den Erntearbeiten mit. Balzlis Schulklasse umfasste die letzten drei Schuljahre von sieben bis neun und zählte, als er seine Arbeit begann, 44 Knaben und Mädchen. In dieser Schule wirkte an der Unterklasse des ersten bis dritten Schuljahrs Fräulein Dora Schweizer, die spätere Gattin Ernst Balzlis. Eine besondere Eigenheit seiner Grafenrieder Schule, die ihm all die Jahre seines Wirkens zu schaffen machte, waren die Pflegekinder, deren Los ihn besonders stark beschäftigte. In seiner Klasse sassen bis zu drei Fünftel des Schülerbestandes Pflegekinder. Die Meisten von ihnen waren in Bauernfamilien der Gemeinde untergebracht. Eine enge Freundschaft verband ihn mit Pfarrer Hutzli, der mehrere Jahre die Kirchgemeinde Grafenried-Fraubrunnen betreute. Balzli sang mit seiner Kollegin und nachmaligen Gattin Dora Schweizer im Kirchenchor und leitete ihn auch eine Zeitlang. Balzlis Verhältnis zur Kirche war beeinflusst durch seine Gattin, deren Vater, Paul Schweizer, bis zu seinem Hinschied in Grafenried Pfarrer gewesen war.
Im September 1925 schloss Ernst mit Dora Schweizer, ursprünglich aus Diemtigen, den Bund der Ehe. Dem Ehepaar blieben eigene Kinder versagt, so sehr sich Ernst, der den Kindern so viel Verständnis und Liebe entgegenbrachte, solche gewünscht hatte. Darum nahmen sie das Töchterchen Vroni an Kindesstatt an, das in ihnen hingebende Eltern fand. Im Jahre 1926 erbauten Ernst und Dora Balzli in der Nähe des Schulhauses, in leicht erhöhter Lage des Dorfes, ihr eigenes Heim, das sie bis zu ihrem Wegzug von Grafenried, im Jahre 1948, bewohnten. Nachdem Ernst in Grafenried kurze Zeit im Kirchenchor mitgesungen hatte, wurde er Mitglied des Männerchors von Grafenried und übernahm bald dessen Leitung. Ein wichtiges Anliegen waren die Theateraufführungen des Männerchors im Winter. Er hat mit seinen Leuten begeistert Theater gespielt, als Regisseur wie als Spieler auf der Bühne.
Ernst Balzli fand bereits als Einundzwanzigjähriger mit seinem Gedicht «Im Schein der Flamme» im Jahre 1923 Eingang in die Zeitschrift «Ernte». Im Jahr 1927 folgten zwei weitere Gedichte «Vom Morgen gegen Abend», «Ich rede mit Gott» und 1929 «Einst». Von 1933 hinweg genoss Balzli in den Zeitschriften «Garbe» und «Ernte» nicht nur gelegentliches Gastrecht, sondern dauerndes Wohnrecht. Nicht weniger als zehn seiner kurzen Geschichten fanden darin Raum: «Der Heiwäg» (1933), «Der Näschtlibutz» (1936), «D’Säimaschine» (1938), «Am Gartetöri» (1940), «Uf em Bänkli» (1947), «Der wyt Wäg» (1949), «Der Wurm im Täfer» (1951), «Vatter Chuenzes Stimm» (1953), «Nach Jahr u Tag», «s’Meitli» (1954) und «Der Sängerchrieg im Buchsiwald» (1954). Als Rudolf von Tavel 1934 starb, er hat die zwei Zeitschriften ins Leben gerufen, übernahm Ernst Balzli die Schriftleitung der «Garbe» (ging 1954 ein) und der «Ernte» (erschien bis 1966).
Die letzten Jahre von Balzlis Wirken in Grafenried wurden überschattet durch die Verschlimmerung des Gesundheitszustandes seiner Gattin Dora, die sich von einer Blinddarmoperation, durchgemacht in jungen Jahren, nie ganz zu erholen vermochte. Auch beim kräftig gebauten, scheinbar kerngesunden Gatten meldeten sich Anzeichen verschiedener Gebrechen. Eine bereits in der Seminarzeit durchgemachten Brustfellentzündung blieb nicht ganz ohne Folgen und äusserte ihre Nachwirkungen in zeitweise Atembeschwerden, die in ein Asthmaleiden ausarteten, dazu kamen Ischiasleiden und Herzbeschwerden. Dies alles hatte eine gewisse Gereiztheit zur Folge, die sich im Umgang mit ihm und namentlich in Schule auswirkte. Immer mehr drängte sich die Notwendigkeit der Veränderung seiner Lage auf, bis in ihm der Entschluss reifte, die Schulstube und auch Grafenried zu verlassen und als freier Schriftsteller mit seinem literarischen Werke zu leben. An Arbeit sollte es kaum fehlen. Die Anfragen zum Vorlesen aus eigenen Werken mehrten sich und seit einigen Jahren arbeitete er bei Radio Bern mit, für das er mit Geschick die Sendung für die Kranken betreute. Inzwischen hatte Direktor Schenker von Radio Bern Balzli die vollamtliche Mitarbeit am Studio angeboten. Balzli nahm das Angebot probeweise für ein Jahr an und liess sich auf den 1. April 1946 für diese Zeit vom Schuldienst dispensieren. Nach einem Jahr erfolgte die feste Anstellung in Bern, worauf er endgültig von der Schule in Grafenried Abschied nahm, behielt aber dort trotzdem seinen Wohnsitz bis zur Pensionierung seiner Gattin vom Schuldienst im Herbst 1948. Damals erfolgte, nachdem das Haus in Grafenried verkauft worden war, der Umzug ins eigene Heim am Knüslihubelweg 11 in Bern. Leider wurden die ersten Monate in Bern überschattet durch die Verschlimmerung des Leidens der Gattin, sie starb am 13. Januar 1949 in ihrem 49. Lebensjahr und liess ihren Gatten mit der Adoptivtochter Vroni allein zurück.
Überblicken wir die vierundzwanzig Jahre von 1922 bis 1946 in Grafenried, dann wird eine Zeit reicher literarischer Ernte sichtbar, die nicht weniger als siebenundzwanzig Veröffentlichungen umfasst. Verglichen mit dem gesamten Werk Balzlis, das im ganzen vierzig Nummern umfasst, sind in den Jahren 1927 bis 1946 ziemlich genau zwei Drittel seiner Werke erschienen. Das heisst, dass in jedem Jahr ein bis zwei Werke der Öffentlichkeit übergeben wurden. Besonders fruchtbar waren die Jahre 1927 und 1928, in denen nicht weniger als vier Arbeiten, ein Gedichtbändchen, ein Band Erzählungen und drei Bühnenstücke vorgelegt wurden. Im Jahre 1942 empfing Ernst einen Preis der Schweizerischen Schillerstiftung, 1943 und 1954 den Literaturpreis der Stadt Bern.
Am 7. Februar 1950 schloss Ernst Balzli seinen zweiten Ehebund mit Alice Vischer von Basel, einer ausgebildeten Kindergärtnerin. Der steile Weg zu seinem Heim in Bern machte ihm von Jahr zu Jahr mehr Mühe, sodass er sich 1954 entschloss, im Jahr seines Rücktrittes vom Radio, in Bolligen am Sternenweg, einen neuen letzten Wohnsitz erbauen zu lassen. Dem Ehepaar Balzli wurden zwei Kinder geschenkt, die am 19. Dezember 1950 geborene Tochter Brigitte und der am 11. September 1952 geborene Sohn Andreas Alfons.
Die Wirkung der Kritik war auf Ernst Balzli nicht ausgeblieben und erwies sich für ihn als niederschmetternd. Er fühlte sich von ihr zutiefst getroffen und geriet so sehr aus dem Gleichgewicht, dass er zur Weiterarbeit beim Radio nicht mehr fähig war, geschweige denn, etwas Eigenes zu schreiben.
Nach seinem Rücktritt vom Schuldienst am 1. April 1958 wusste Ernst, dass seinem Leben nur noch eine kurze Zeitspanne vergönnt war. Er empfand das Bedürfnis, sich vermehrt der Gattin und den Kindern zu widmen. In der Nacht auf den 3. Januar 1959 verschied Ernst Balzli in seinem Heim, in seiner Heimatgemeinde Bolligen an einer Herzkrise. Der Direktor des Radio Bern, Dr. Kurt Schenker, liess sich wie folgt vernehmen: «Zehntausende von Radiohörern, neben vielen Lesern seiner Bücher, trauern um den Tod von Ernst Balzli. Er ist für sie, nicht zuletzt durch seine hörfolgemässigen Bearbeitungen Gotthelfscher Stoffe, ein Begriff geworden».
Quelle: Buch «Ernst Balzli, Leben und Werk», Verfasser Hermann Wahlen, erschienen im Viktoria-Verlag Ostermundigen 1973, |




